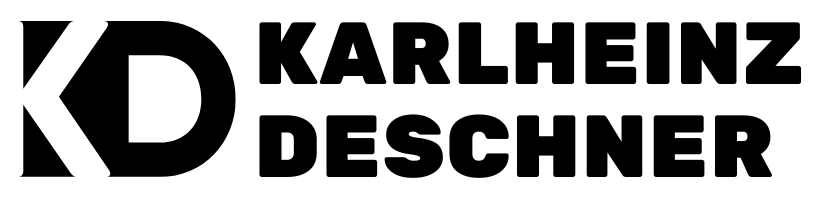Warum – warum bin ich, tief überzeugt doch, dass unser Fleisch wie Gras, wie ein Wind-Hauch vergeht, dass man den Staub eines Königs noch sehen kann, wo er ein Spundloch verstopft, dass unsre ganze gloriose Geschichte – dies Danaiden‑, dies Sisyphus-Spektakel, diese vergleichsweise lächerlich kraftlose Exaltation – sternschnuppenhaft verglühen wird unter dem eisigen Schweigen des unendlichen Raums über uns, das Pascal so erschreckt, warum also bin ich, ist all dies, Wissenschaft wie Kunst, Weltreiche und Weltreligionen und die immer fataler Welt wie Mensch verwirtschaftende Weltwirtschaft sub specie aeternitatis, um nicht zu pathetisch zu sein, doch für die Miezekatz – warum bin ich armer Tor mit achtzig Jahren noch so wenig „geläutert“, „gereift“, so geistig unbescheiden-eitel, dass ich mich feiern lasse wie einen Preisochsen!?
Ich bin gehalten, meine Damen und Herren, nicht mit Kassandra-Rufen, mit allerlei trüben pessimistischen Absichten, Ansichten, Einsichten, Aussichten die Feststimmung zu vermiesen. Doch beiseite, dass der ja kaum gestreifte Vanitas-Vanitatum-Aspekt zwar unbestreitbar trüb, trist, aber ganz realistisch ist: ich kann einfach – zu Lebzeiten – aus meiner Haut nicht heraus, wie Sie alle nicht aus der Ihren, und gerade das sei kurz thematisiert.
Doch zuvor noch: Warum diese Feier? Nun, etwas professionelles Denken sprach da schon mit, Rücksicht auf Verleger, auf Agenten, Übersetzer, Förderer, Fans, die alle, wie vom folgenden Autorentod, so auch von dessen augenfälligen Vorboten, den „besonderen“ Altersgeburtstagen eben und deren Zelebration, eine kleine Publizitätswelle erwarten – der Autor macht sich auch hier wenig vor. Doch ein sehr egoistisches Motiv hatte er, den Wunsch nämlich, so noch einmal viele ihm liebe, von ihm hochgeschätzte Menschen zu sehen, deren meiste er sonst wohl nie mehr sehen würde.
Vielleicht ist ja auch das noch von Eitelkeit, Ehrgeiz angekränkelt, obwohl ich aufrichtig bekenne, was überraschen, bezweifelt werden mag, dass ich auf das, was ich schrieb, auf meine Lebensarbeit, nie stolz gewesen bin und mir auch heute nichts darauf zugute halte. Denn alle Schaffenselemente sind Dotationen von fernher, von Ahnen, von Ungezähltem, das auf sie wirkte, von Leuten, Völkern, nie von uns erblickten Landschaften, nie erfahrenem Erleben. Alle Faktoren der Intelligenz, Kreativität, des Fleißes, die Fähigkeit zu reagieren oder nicht oder so und nicht anders, all dies und tausend mehr ist bekanntlich Ergebnis dessen, was in uns angelegt und zumal in früher Kindheit beeinflusst worden ist, wobei sowohl das Vererbte wie das durch Erziehung Bedingte gleichmächtig die Programmierung der Gehirnfunktionen bestimmt.
Spinoza schrieb, ich zitiere aus dem Gedächtnis: wenn ein Stein, den man wirft, während seines Flugs plötzlich Bewusstsein bekäme, würde er auch denken, wie fliege ich doch so herrlich frei dahin!
Ich spreche, notgedrungen vereinfachend, von den Auseinandersetzungen gleichsam mit uns selbst, den Direktiven, die wir uns in scheinbar eigener Machtvollkommenheit erteilen, während wir in Wirklichkeit der Spielball ganzer Kaskaden von Befindlichkeiten, Neigungen, Trieben, von unbewussten Strebungen sind, weniger ihr Herr als ihr Knecht.
„Ich will“ – ein Euphemismus, Schönfärberei, Illusion. Der Mensch kann zwar tun, was er will, so Schopenhauer, doch nicht wollen, was er will. Gewiss meinen wir, die Wahl zu haben, haben sie aber nur abstrakt zwischen zwei, drei, vielen Möglichkeiten. Tatsächlich tun wir, umzingelt von neuronalen Prozessen, Motivsituationen, von unbewussten Komplexvorgängen, immer nur das Eine, gelenkt vom stärksten Motiv.
Unser Wille ist also kein besonderes Seelenvermögen, dies der einhellige Befund führender Neurowissenschaftler, ist nicht die treibende Kraft unserer psychophysischen Aktivitäten, sondern ein Konstrukt. Er ist stark oder schwach, doch stets vorgeprägt, stets abhängig von Reiz und Reaktion, dem unheimlich komplizierten Zusammenspiel nervaler Geflechte im Hirn, von Neuronen, Fibrillen, Synapsen; er ist nie ursachlos, vielmehr, wie anderes Naturgeschehen – ein Axiom szientifischer Forschung – dem Kausalgesetz unterworfen. Die Quantentheorie, von den Verteidigern der Willensfreiheit oft beschworen, hat damit absolut nichts zu tun. Bedeutende Physiker des 20. Jahrhunderts, Einstein, Oppenheimer, haben sich von den indeterministischen Wunschträumen klar distanziert.
Das Gefühl der Willensfreiheit, teils optische Täuschung, teils bewusste Falschmünzerei, wurde seit langem im Menschen herangezüchtet und schmeichelt auch nicht wenig seinem Selbstbewusstsein. Zudem fühlen wir uns oft frei, frei von dem oder jenem, frei für dieses und das, sind aber durch eine unerforschbare Vielzahl äußerer und innerer Gegebenheiten bestimmt, die zwar nicht das Gefühl der Freiheit verhindern – doch die Freiheit. Ergo geht es uns wie dem Lauf des Wassers, das seinen Weg nimmt, sind wir nicht freier als der Schauspieler im Stück, als die Marionette im Theater, als der Kettenhund an der Kette – nur unsere Kette ist länger. Alles im Leben geschieht so freiwillig wie unsre Geburt. Oder unser Tod. Denn selbst wenn wir ihn scheinbar freiwillig herbeiführen – wieviele Zwänge stehen dahinter!
Kein Grund somit, ich fasse zusammen, auf eine Leistung stolz zu sein: Einerseits stammen sämtliche Voraussetzungen dafür von anderen, andererseits ist unser eigenes Handeln gänzlich necessisiert, das heißt unausweichlichen Zwangsläufigkeiten unterworfen.
Nun steht der positiven Determiniertheit die negative gegenüber. Und so wenig der Begünstigte („Jeder ist seines Glückes Schmied!“, was für ein Unsinn!) für sein Glück kann, so wenig der Benachteiligte („Selber schuld!“, derselbe Quatsch!) für sein Pech.
Schon Lichtenberg mahnt: „Wenn du die Geschichte eines großen Verbrechers liesest, so danke immer, ehe du ihn verdammst, dem gütigen Himmel, der dich mit deinem ehrlichen Gesicht nicht an den Anfang einer solchen Reihe von Umständen gestellt hat.“ Und der von Lichtenberg gar nicht geschätzte Goethe gesteht doch ganz in seinem Sinn: „Ich kann mir kein Verbrechen denken, das ich nicht unter den gegebenen Umständen auch hätte tun können.“ Nietzsche urteilt sogar, reiche die Kenntnis eines Delikts und seiner Vorgeschichte nur weit genug, müssen die von einem Verteidiger der Reihe nach erbrachten so genannten Milderungsgründe „endlich die ganze Schuld hinwegmildern“.
Gewiss, wenn Kriminelle, die übelsten, schändlichsten selbst, viele weltliche wie geistliche Potentaten, nicht schuldfähig, wenn sie sozusagen entschuldet sind, heißt das keinesfalls, die Gesellschaft solle ihnen gegenüber untätig sein. Sie muss sich natürlich schützen, möglichst jedoch schon präventiv, indem sie allen ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht bzw. dessen Saboteure, Ruinierer rechtzeitig entmachtet.
In der Reaktion aber auf die Gescheiterten ist ein Umdenken notwendig. Anstelle des alteingewurzelten, noch alttestamentarischen Vergeltungsschemas – Aug um Aug, Zahn um Zahn, welch unendliches Unheil resultiert daraus! –, anstelle dieses schier ewigen Schuld- und Sühneschreis muss, so verdammenswert die kriminelle Tat ist und bleibt, das Verstehen, die wirkliche Sozialisierung des Täters treten, was viele Experten, Ethologen, Biologen, Psychologen, Anthropologen, Soziologen, auch namhafte Strafrechtsreformer wie Fritz Bauer oder Eduard Kohlrausch, längst fordern.
Denn gerächt ist nicht gerecht, Rache nicht Gerechtigkeit. Verabscheuenswert ist nicht der unter dem ehernen Zwang der Bedingtheiten Gestrandete, sondern wer ihn vom hohen Ross aus so überheblich wie dummdreist verdammt. Je primitiver ein Mensch, je ahnungsloser, unbelehrter, und sei er noch so gelehrt, desto lauter das berüchtigte Rübe-ab-Gebrüll, ohne tieferes Verständnis für die Gründe und Abgründe eines jeden von uns, des Glücklichen wie des Unglücklichen.
Ganz anders dagegen, um auch mal ans Christentum zu erinnern, so manches Verhalten des synoptischen Jesus (denn von einem historischen, Ergebnis jahrhundertelangen theologischen Forschens, wissen wir so gut wie nichts), wie anders doch der synoptische Jesus, der Umgang pflegt auch mit Sündern, mit Huren, der „in schlechter Gesellschaft“, ein theologischer Buchtitel, lebt. Der auf ihn rekurrierende Klerus aber ist vom 4. Jahrhundert bis heute der Kollaborateur der Mächtigen, der Unterdrücker, Ausbeuter, ist Komplize jener, die die Völker vergewaltigen und sich dafür, so sagt dieser Jesus, auch noch „Wohltäter“ nennen lassen (Lk. 22,25; vgl. Mt. 20,25). Mir wirft man vor, nur das Negative der Kirche zu sehen. Doch was wäre kritikwürdiger als die Verkehrung fast all dessen, was etwa die Bergpredigt preist, ins Gegenteil während einer zweitausendjährigen Geschichte von Tränen und Blut!
In der Praxis der Kirche also, die sich auf Jesus beruft, gab es, wie in den anderen monotheistischen Religionen, Ausnahmen und Augenwischereien beiseite, kein verstehendes Erbarmen mit den „Sündern“, sondern ein nahezu endloses Arsenal von Strafen, oft schrecklichsten, bis hin zum Scheiterhaufenfeuer, bis hin zur permanenten Androhung ewigen Höllenfeuers; stets, versteht sich, unter Voraussetzung der Lehre vom freien Willen, die der Klerus, wie jede Obrigkeit, braucht, um strafen zu können. Denn der Klerus besteht auf der Strafe, er lebt von der Strafe, er liebt die Strafe, vom Beichtvater bis zum Himmelvater, dem lieben, straft da alles. Ja, nur des Strafens wegen, höhnt Nietzsche, haben die Priester den freien Willen erfunden, dies „Folter-Instrument“, dies „anrüchigste Theologen-Kunststück“ – allen Prädestinationsdoktrinen, allen Behauptungen von Vorherbestimmung des Einzelnen zur Seligkeit oder Verdammnis durch Gottes „Gnadenwahl“ zum Trotz: eine Paradoxie ohnegleichen.
Dagegen erhoffen auch namhafte Vertreter der neuesten Hirnforschung von der radikalen Revision der indeterministischen Vorstellung zugunsten einer genetisch-biographischen Determiniertheit unseres Wesens und Wollens ein gänzlich anderes Verhalten gegenüber den Verlierern, den Verfemten der Gesellschaft: nicht rechthaberisch, nicht arrogant, sondern demütig und bescheiden, kurz ein vom Verstehen geprägtes Lebensgefühl.
Kein Grund somit zu selbstgerechtem, ja verachtungsvollem Dünkel gegenüber den Zukurzgekommenen, die, weniger begünstigt, weniger Glück hatten als wir, die scheiterten. Früher oder später trifft es jeden von uns, ereilt es uns alle gleich dem Kranich, dessen Klage ich einst in der Herbstnacht vernahm, immer tiefer, näher sinken hörte, immer breitere bresthafte Schreie voller Qual zum Himmel hin, wo der Ruf der Genossen fortzog, rasch leiser werdend ins Dunkel glitt, abschiednehmend vielleicht, vielleicht aber auch ganz unberührt, nur langhalsig schwingendes Singen der Luft um sich, nur Neuem, Lockendem, Fernem zu, bis einmal freilich auch jeder von ihnen fallen, verschwinden wird, weil alles Fleisch wie Gras, wie ein Wind-Hauch vergeht …
Ich blicke nicht ohne große Trauer auf mein Leben zurück; doch tief dankbar allen, die mitwirkten daran, mein Denken prägend, Fühlen, Schreiben. Dankbar jenen, die mich, weit mehr noch als der Krieg, dem Blut- und Heuchelwahn des Christentums entrissen: Kant, Schopenhauer, Nietzsche. Dankbar so vielen großen Dichtern, Malern, dankbar Anton Bruckner zumal. Dankbar denen, ohne die ich nicht wäre heute: meinen Eltern zuerst, der Familie in der Kindheit, der Familie später, zahlreichen Freunden, Helfern, meist in den Widmungstabellarien der Kriminalgeschichte des Christentums genannt, wahre Glücksfälle darunter. Vor allem Fredi Schwarz, der so großzügig wie verständnisvoll und uneigennützig an meinem Schaffen teilnahm: Übrigens nicht nur mir beistand, sondern etwa, wenn auch auf ganz andre Weise, und dies sei nicht bloß curiositatis causa gesagt, auch dem wiederholt von ihm Hilfe erbittenden Apostolischen Legaten Roncalli, dem späteren Papst Johannes XXIII. Als Fredi Schwarz, zuletzt in Luzern lebend, starb, trieb Herbert Steffen (aus dem Hunsrück) prononciert die Kriminalgeschichte voran, und ohne sein ein Jahrzehnt währendes ungewöhnliches Engagement schriebe ich jetzt nicht den 9., sondern wohl erst den 7. Band. Das ganze Unternehmen aber begleiten nun schon 34 Jahre lang, seit 1970, Rowohlt und sein Lektor Hermann Gieselbusch, unermüdlich dieser, geduldig (meistens) und sehr klug.
(Es folgen weitere Danksagungen, u. a. an die früheren Laudatoren Jan Philipp Reemtsma, Horst Herrmann, Klaus Sühl, Ludger Lütkehaus, Johannes Neumann sowie an den Hauptredner vom 23. Mai 2004, Hermann Josef Schmidt, und nicht zuletzt an den ohne Gage spielenden Weltklasse-Pianisten Igor Kamenz.)